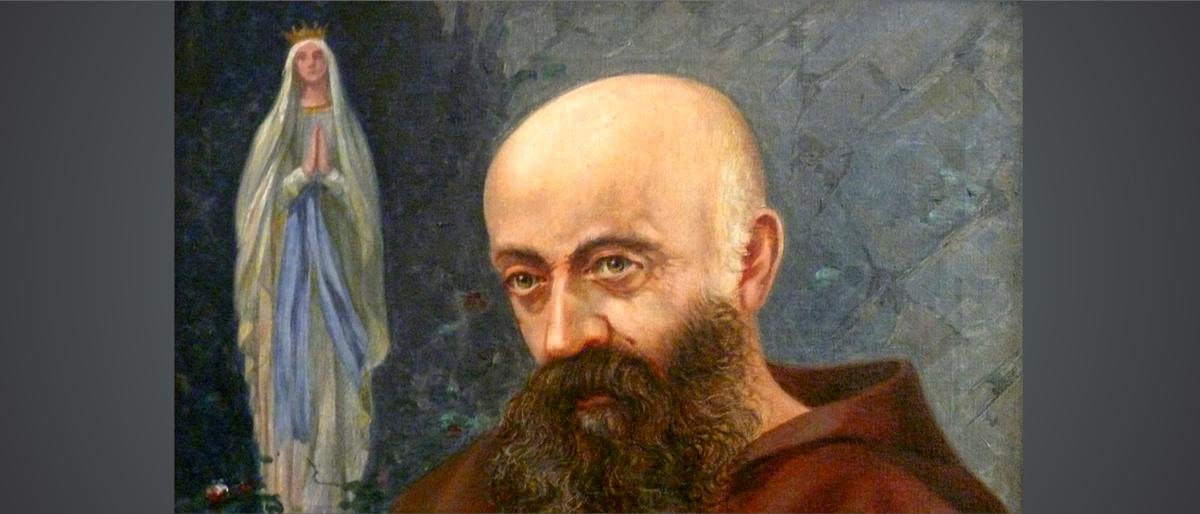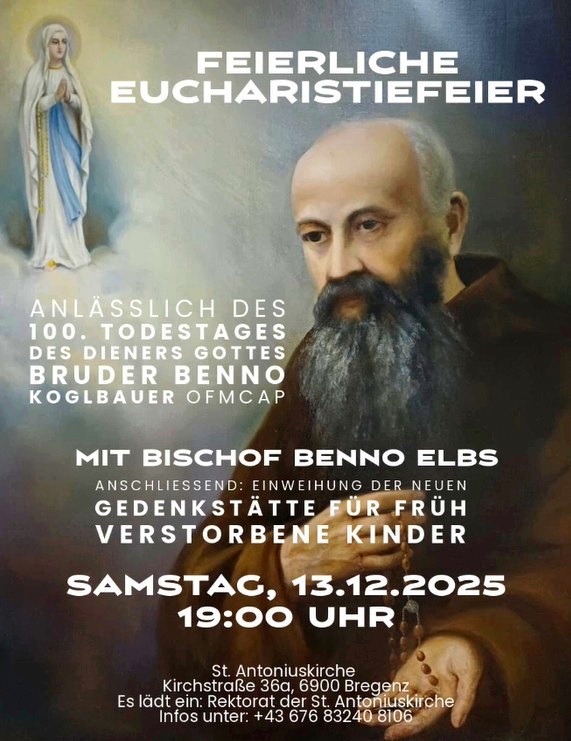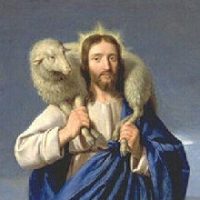Am 15. September 2025, dem Gedenktag der Schmerzen Mariens, wurde in Rom das „Jubiläum des Trostes“ begangen. Bei einer Gebetswache im Petersdom gab Diane Foley aus den USA ein berührendes Zeugnis darüber, was es für sie bedeutet hat, mit Maria unter dem Kreuz Christi zu stehen.
Am 15. September 2025, dem Gedenktag der Schmerzen Mariens, wurde in Rom das „Jubiläum des Trostes“ begangen. Bei einer Gebetswache im Petersdom gab Diane Foley aus den USA ein berührendes Zeugnis darüber, was es für sie bedeutet hat, mit Maria unter dem Kreuz Christi zu stehen.
Ihr Sohn, James Wright Foley arbeitete als unabhängiger Journalist. 2011 wurde er bei seiner Berichterstattung aus Libyen von Dschihadisten für 44 Tage entführt. „Wir waren in tiefer Panik und Angst um sein Leben.“ „Unsere Kirchengemeinde versammelte sich um uns herum und gab uns mit ihren Gebeten Hoffnung.“
„Als Jim nach Hause zurückkehrte, war er ein anderer Mensch. Sein Glaube war tiefer geworden. Während seiner Gefangenschaft hatte er auf seinen Fingern den Rosenkranz gebetet und durch Bibelverse von einem anderen Gefangenen Hoffnung geschöpft. Er kam mit einem neuen Lebenssinn nach Hause. Er strebte danach, ein Journalist mit moralischem Mut zu sein und den Stimmlosen eine Stimme zu geben.“ Als seine Mutter ihn anflehte, nicht in das Konfliktgebiet zurückzukehren, sagte er einfach: „Mama, ich habe meine Leidenschaft gefunden.“ Am 22. November 2012 verschwand er für zehn lange Monate. „Wir wussten nicht, ob er tot oder lebendig war.“
Die Mutter gab ihre Arbeit als Krankenschwester auf und verbrachte die nächsten 20 Monate mit dem verzweifelten Versuch, die Freilassung ihres Sohnes zu erreichen. Mitte Juli 2014 war sie völlig erschöpft. „Schließlich wurde mir klar, dass ich Jim übergeben musste, also ging ich in unsere Anbetungskapelle und vertraute Jim unserem Gott an. In diesem Moment war ich zuversichtlich, dass Gott Jim befreien würde. Zwei Wochen später wurde Jim brutal und gewaltsam enthauptet.“
„Er wurde fast zwei Jahre lang geschlagen, ausgehungert und gefoltert, bevor er im August 2014 geköpft wurde.“
„Ich war geschockt, völlig fassungslos. Als mir diese Realität bewusst wurde, stieg Wut in mir auf – Wut auf ISIS, auf unsere US-Regierung, auf diejenigen, die sich geweigert hatten zu helfen. Und Bitterkeit drohte mich zu verschlingen. Ich erinnere mich, dass ich zu Gott schrie: Herr, das ist nicht das, was ich gemeint habe, als ich Jim dir übergeben habe. Wie kann das sein? Ich taumelte unter der Last dieses Verlustes und war mir nicht sicher, ob ich weitermachen konnte. In diesen dunklen Momenten betete ich verzweifelt um die Gnade, nicht bitter zu werden, sondern vergebungsbereit und barmherzig zu sein.
Jesus und Maria wurden meine ständigen Begleiter, zusammen mit unzähligen irdischen Engeln, deren Mitgefühl mich aufrichtete. Marias Beispiel hat mich besonders stark beeinflusst. Sie begleitete ihren Sohn durch seine Qualen und seine Kreuzigung.
Auch wenn sie nicht verstand, warum es so kommen musste, vertraute Maria und blieb treu. Sie hat mich gelehrt, dasselbe zu tun – im Glauben zu wandeln, egal was kommt. Die Kreuzwegstationen haben mir gezeigt, wie nah Jesus und seine heilige Mutter uns sind, wenn wir leiden.“
Im Jahr 2021 wurden zwei der Verbrecher, die ihren Sohn entführt und gefoltert hatten, verhaftet und in Virginia, Vereinigte Staaten, vor Gericht gestellt. Alexander Cody bekannte sich in allen Anklagepunkten der Entführung, der Folter und des Mordes schuldig und bot unerwartet an, sich mit den Familien der Opfer zu treffen. Diane Foley wollte ihn sehen, aber andere drängten sie, dies nicht zu tun, da er sie „nur anlügen“ würde. Das Treffen wurde möglich und der Täter „drückte viel Reue aus“. „Gott gab mir die Gnade, ihn als einen Mitsünder zu sehen, der wie ich der Barmherzigkeit bedarf“, sagte Diane Foley.