 Dr. John Bruchalski war in einer gläubigen Familie groß geworden. Aber nach seinem Universitätsabschluss warf er allen Glauben über Bord. 1983 wurde er Dozent für Medizin in South Alabama.
Dr. John Bruchalski war in einer gläubigen Familie groß geworden. Aber nach seinem Universitätsabschluss warf er allen Glauben über Bord. 1983 wurde er Dozent für Medizin in South Alabama.
Er erzählt: „Verhütung, Abtreibung schienen mir die am besten geeigneten Mittel, um den Frauen die Gesundheit, das Glück und die Fülle des Lebens zu garantieren.“
Doch es schlichen sich auch Zweifel ein. „Ich erlebte bei den Frauen weder Freude noch Glück in meiner Klinik. Je mehr Abtreibungen ich durchführte, umso mehr nahm die Verhütungspraxis zu, vermehrten sich die Infektionen, Komplikationen und Trennungen der Paare. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte, denn meine Kollegen meinten nur: ‚Wir brauchen bessere Schulung und mehr Verhütung, mehr Abtreibung!!'“
Eines Tages hat ihn seine Mutter zu einer Wallfahrt eingeladen. Dort geschah die Umkehr, dort wurde er von der Gnade Gottes berührt. Nach Hause zurückgekehrt, weigerte er sich, weitere Abtreibungen oder Sterilisationen durchzuführen. „Diese Pilgerfahrt hat mir nicht nur Klarheit über mich selber gebracht, sondern auch die Einsicht, dass es einen anderen, einen besseren Weg gab, meinen Beruf als Arzt auszuüben.“ Seit 1994 arbeitet er nun in seinem Family-Center nach den Grundlagen der katholischen Glaubenslehre als Arzt und Mediziner.
Die neuesten Beiträge
Alles ist leicht, wenn beide das gleiche Ziel haben!
 Ein Zeugnis
Ein Zeugnis
Ich bin eine glückliche Frau, 8 Jahre verheiratet; wir haben 3 Kinder. Berufstätig war ich nur bis zu meiner Eheschließung, denn dann wollte ich nur noch Frau und Mutter sein. Es ist wohl besser, etwas weniger Geld, nur ein Auto, keinen Fernsehapparat usw., dafür aber etwas mehr Zeit für Mann und Kinder zu haben. Dieses Sich-Zeit-Nehmen für die Seinen ist eines der wichtigsten Dinge, um eine Ehe glücklich führen zu können. Der Mann sucht nach der Hast des Tages wenigstens daheim Ruhe und Ausgeglichenheit, und auch die Kinder wollen nicht nur gefüttert und ins Bett gebracht werden, sondern brauchen die Liebe der Mutter von früh bis spät, um richtig gedeihen zu können. Jedes der drei Kinder wurde mit großer Sehnsucht und Liebe erwartet. Wir haben uns bemüht, einer auf den anderen einzugehen, am anderen nicht nur die Fehler zu sehen, sondern in erster Linie das, was er gut macht… Das gemeinsame Gebet daheim bindet auch sehr stark, besonders der Rosenkranz, den wir oft beten und von dem sichtlich viele Gnaden ausgehen. Freilich muss man immer wieder Opfer bringen. Aber alles ist leicht, wenn beide das gleiche Ziel vor Augen haben: innerlich zu wachsen und reif zu werden für die Ewigkeit.
—————
Quelle: http://www.bewegung-fuer-das-leben.com/files/lebe_109.pdf
Brot vom Himmel hast du uns gegeben
 In den Sonntagsevangelien im August hören wir Abschnitte aus der so genannten „Brotrede“, die Jesus in Kapharnaum gehalten hat. Jesus spricht davon, dass er das lebendige Brot vom Himmel ist. Und er gibt uns die Verheißung: „Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.“ Was Jesus hier angekündigt hat, das hat er in der heiligen Eucharistie verwirklicht.
In den Sonntagsevangelien im August hören wir Abschnitte aus der so genannten „Brotrede“, die Jesus in Kapharnaum gehalten hat. Jesus spricht davon, dass er das lebendige Brot vom Himmel ist. Und er gibt uns die Verheißung: „Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.“ Was Jesus hier angekündigt hat, das hat er in der heiligen Eucharistie verwirklicht.
Wir brauchen nicht nur leibliche, sondern auch geistige Nahrung. Die Seele kann nicht leben, wenn sie nicht durch die Gnade Gottes genährt wird. Wir brauchen Liebe, Wahrheit, den Sinn des Lebens, die Hoffnung … Das alles schenkt uns Jesus Christus durch das Sakrament seines Leibes und Blutes. Er selbst ist also die wahre Nahrung, damit wir nicht seelisch verkümmern.
Aber wie er bei der Brotvermehrung die Jünger beauftragte, das Brot an die anderen zu verteilen, so gibt uns der Herr den Auftrag, die Gnaden, die wir im Sakrament der Eucharistie empfangen, an unsere Mitmenschen weiterzuschenken. Was dies konkret bedeutet, das können uns die Heiligen am besten zeigen.
Die sel. Mutter Teresa von Kalkutta z.B. hat dies in außergewöhnlicher Weise verwirklicht. Sie hat erkannt, dass dieses „Brot der Liebe“ das Wichtigste ist, das die Menschen brauchen. Sie sagt: „In den vielen Jahren meiner Arbeit unter den Menschen ist mir immer klarer geworden, dass die schwerste Krankheit, die ein menschliches Wesen überhaupt erfahren kann, die ist, unerwünscht zu sein. Wir haben Arzneien für Lepra, und Aussätzige können geheilt werden. Für alle Arten von Krankheiten gibt es Arzneien und Heilmittel. Aber diese schreckliche Krankheit, unerwünscht zu sein, kann, glaub ich, nie geheilt werden, außer durch willige Hände, die dienen, und ein liebendes Herz, das liebt.“ Aus der Eucharistie empfing sie die Kraft zur Liebe: „Wir beginnen unseren Tag, indem wir versuchen Christus in der Gestalt des Brotes zu sehen. Und während des Tages fahren wir fort, ihm in den ausgemergelten Körpern unserer Armen zu begegnen und die Liebe Gottes weiterzuschenken.“ – „Wie groß ist die Liebe, die Jesus uns in der Eucharistie zeigt. Er wird selbst zum Brot des Lebens um unseren Hunger nach Liebe zu stillen. Und er wird selbst zum Hungrigen, damit wir seine Liebe zu uns stillen können.“
Der hl. Pfarrer von Ars sagt:
„Man spürt es, wenn eine Seele das Sakrament der Eucharistie würdig empfangen hat. Sie ist so in Liebe versunken, von ihr durchdrungen und verändert. Sie ist demütig, liebenswürdig und bescheiden; sie ist eine zu den größten Opfern fähige Seele.“
Eucharistie – Sie kniete nieder
 Am 9. Aug. feiern wir in der Kirche das Fest der hl. Edith Stein (1891-1942). In einem ihrer Bücher beschreibt sie ein für sie unvergessliches Erlebnis aus dem Jahr 1916, das sie später zum Glauben an die Gegenwart des Herrn in der Eucharistie führte und wichtig war für ihren Weg in die katholische Kirche.
Am 9. Aug. feiern wir in der Kirche das Fest der hl. Edith Stein (1891-1942). In einem ihrer Bücher beschreibt sie ein für sie unvergessliches Erlebnis aus dem Jahr 1916, das sie später zum Glauben an die Gegenwart des Herrn in der Eucharistie führte und wichtig war für ihren Weg in die katholische Kirche.
Sie stammte aus einem streng religiösen jüdischen Elternhaus, bezeichnet sich selbst in dieser Zeit als Atheistin. Bei einem Besuch bei ihrer Freundin Frau Reinach in Frankfurt ging sie auf einem Spaziergang durch die Altstadt auch in den Dom.
„Während wir in ehrfürchtigem Schweigen dort verweilten, kam eine Frau mit ihrem Marktkorb herein und kniete zu kurzem Gebet in einer Bank nieder. Das war für mich etwas ganz Neues. In die Synagogen und in die protestantischen Kirchen, die ich besucht hatte, ging man nur zum Gottesdienst. Hier aber kam jemand mitten aus den Werktagsgeschäften in die menschenleere Kirche wie zu einem vertrauten Gespräch. Das habe ich nie vergessen können. „
Die Marienverehrung ist wichtig für die Zukunft
 Pater Bruno Haider, der Kirchenrektor der Kapuzinerkirche feiert am 27. Juni 2012 sein silbernes Priesterjubiläum – ein Grund zur Dankbarkeit und Freude. Die Redaktion des „St. Antonius Blattes“ stellte ihm die folgenden Fragen:
Pater Bruno Haider, der Kirchenrektor der Kapuzinerkirche feiert am 27. Juni 2012 sein silbernes Priesterjubiläum – ein Grund zur Dankbarkeit und Freude. Die Redaktion des „St. Antonius Blattes“ stellte ihm die folgenden Fragen:
P. Bruno, was kannst du uns über deinen Werdegang und deine Berufung sagen?
Am 27. Juni 1987 wurde ich zusammen mit meinem jüngeren Bruder Christoph zum Priester geweiht. In Hall in Tirol feierten wir unsere Doppelprimiz. Mein Primizspruch „Wir haben die Liebe erkannt und an die Liebe geglaubt“ (1 Joh 4,16) fasste für mich die Erfahrung der Berufung zusammen. Mit etwa 17 Jahren, als ich andere Interessen hatte, machte mich eines Tages jemand darauf aufmerksam, dass Jesus Christus mir in der Eucharistie sein großes Interesse entgegenbringt. Gleichzeitig berührte mich das Lesen der Evangelien in einem kleinen Neuen Testament, das mir meine Taufpatin zum 15. Geburtstag geschenkt hatte. Nach der Priesterweihe stand ich 9 Jahre im Dienst der Diözese Innsbruck als Kooperator, Dekanatsjugendseelsorger, Pfarradministrator in Sillian und als Pfarrer in Nassereith. Damals erlebte ich immer stärker den Ruf, Christus in einem gemeinschaftlichen Leben nach den 3 Evangelischen Räten – Jungfräulichkeit, Armut und liebendem Glaubensgehorsam – nachzufolgen. Ich trat in die Priestergemeinschaft der geistlichen Familie „Das Werk“ ein und kam nach Bregenz ins Kloster Thalbach. Schon in meiner Jugend hatte ich die Gründerin der Gemeinschaft, Frau Julia Verhaeghe, als beeindruckende Persönlichkeit der Kirche und geistliche Mutter kennen gelernt. Durch die Noviziatszeit wurde ich nun vorbereitet, eine noch engere Bindung und Weihe an Gott zu vollziehen. Als „Pater“ wirkte ich seither in der Seelsorge für Familien, im Religionsunterricht – so in Feldkirch-Gisingen und in Lindau -, weiters in der Pfarrseelsorge im Pfarrverband Teisendorf/Oberbayern. Seit vier Jahren betreue ich die Rektoratskirche zum hl. Antonius – Kapuzinerkirche in Bregenz, die seelsorglich dem Bischof von Feldkirch unterstellt ist.
Was motivierte und freute dich in deinem bisherigen Priesterleben besonders?
In meinem Leben als Priester motivierte mich die Gewissheit: Gott selbst wirkt das Heil der Menschen – ich darf dazu beitragen. Besondere Freude machte mir, die Sakramente zu spenden und Menschen auf deren Empfang vorzubereiten; und natürlich auch, die Sakramente selber zu empfangen. In ihnen sehe ich die Garantie, dass das Heil nicht etwas Selbstgemachtes, sondern etwas von Christus Geschenktes ist. Als eines der schönsten Erlebnisse empfand ich, wie einmal eine Person nach 67 Jahren wieder das Bußsakrament in Anspruch nehmen wollte. Kinder und Kranke waren für mich auf meinem Weg als Priester immer ein erfreuliches Beispiel für Menschen, die sich etwas schenken lassen und nicht alles selber machen wollen.
Wie siehst du die aktuelle Lage der Kirche? Was erhoffst du dir für die Kirche in der Zukunft?
Das scheint mir die größte Aufgabe für die Kirche in unserer Zeit zu sein: vom Menschengemachten hin zum Gottgestifteten zu finden. Als Priester betrachte ich mich als eine Art „Türöffner“ für Gottes Initiative uns Menschen gegenüber. Für die Zukunft der Kirche halte ich die Verehrung der Gottesmutter Maria für besonders wichtig. In Maria, die als „voll der Gnade“ gegrüßt wird, leuchtet uns der Vorrang der Gnade auf. Auf diese Gnade antwortete die Jungfrau von Nazareth mit ihrem „es geschehe“. Darin ist Maria Urbild und Vorbild der Kirche. Weiters wünsche ich, dass viele Menschen das Herz Jesu Christi entdecken. Es empfindet für jeden „eine persönliche Liebe und will diese Liebe in jedem Herzen nähren“ (vgl. Mutter Julia Verhaeghe). Vom Herzen Jesu angezogen, können viele Menschen aufs Neue Heimat in Gott finden. Dafür erfüllt die Kirche einen unersetzbaren Dienst.
Der Sieg der Liebe
 Als ich in Rumänien in einem kommunistischen Gefängnis war, traf eines Tages in unserer Zelle, die für Christen reserviert war, ein neuer Häftling ein. Es war der bekannte Hauptmann Popescu. Unsere Überraschung war groß, erkannten wir in ihm doch jenen Folterer, unter dem die Christen am meisten gelitten hatten. Zu den Opfern gehörten auch einige Insassen dieser Zelle. Wir fragten ihn, wie er denn einer der unseren geworden sei.
Als ich in Rumänien in einem kommunistischen Gefängnis war, traf eines Tages in unserer Zelle, die für Christen reserviert war, ein neuer Häftling ein. Es war der bekannte Hauptmann Popescu. Unsere Überraschung war groß, erkannten wir in ihm doch jenen Folterer, unter dem die Christen am meisten gelitten hatten. Zu den Opfern gehörten auch einige Insassen dieser Zelle. Wir fragten ihn, wie er denn einer der unseren geworden sei.
Mit Tränen in den Augen erzählte er, daß eines Tages ein etwa 12-jähriges Mädchen mit einer Blume in der Hand in sein Büro gekommen sei und zu ihm gesagt habe: „Herr Offizier, Sie sind der Mann, der meine Eltern eingesperrt hat. Heute hat meine Mutter Geburtstag. Für gewöhnlich habe ich ihr an diesem Tag Blumen geschenkt. Ihretwegen habe ich nun keine Mutter, der ich heute eine Freude machen könnte. Aber meine Mutter ist gläubig, und sie lehrte mich von klein an, meine Feinde zu lieben und Böses mit Gutem zu vergelten. Ich möchte darum der Mutter Ihrer Kinder eine Freude machen. Bitte bringen Sie diese Blumen Ihrer Frau und sagen Sie ihr, dass ich sie liebe und Gott sie auch liebt.“
Das war sogar für einen kommunistischen Offizier zuviel. Er umarmte das Kind und konnte von da an nicht mehr foltern. Das führte zu seiner Entlassung und Verfolgung und schließlich dazu, dass er verurteilt wurde, mit uns zu leiden.
————————
Quelle: Aus einem Bericht des evangelischen Pfarrers Richard Wurmbrand
Wie stirbt ein Atheist?
 Im Jahr der Priester 2009/10 hat der Heilige Vater die Priester eingeladen, zum Thema „Sternstunden im Priesterleben“ Erlebnisberichte an ihn zu senden. Aus den etwa 1000 Berichten hier der Bericht von Pfarrer Carlos Morin aus Kolumbien:
Im Jahr der Priester 2009/10 hat der Heilige Vater die Priester eingeladen, zum Thema „Sternstunden im Priesterleben“ Erlebnisberichte an ihn zu senden. Aus den etwa 1000 Berichten hier der Bericht von Pfarrer Carlos Morin aus Kolumbien:
Ich war Kaplan in der Klinik Santa Fe in Bogota. Eines Tages wurde ich zu einem Patienten gerufen, wo mir nicht gesagt worden war, dass er ein Atheist war, ungläubig.Wie ich sein Zimmer betrete, fragte er mich: „Bist du Priester?“ „Ja, mein Herr.“ „Dann verschwinde! Denn ich brauch keinen Pfarrer.“ Ich bin aber geblieben, schweigend und ohne mich zu bewegen. „Warum gehst du nicht?“, fragte er genervt. Meine Antwort kam völlig unüberlegt, wie aus einem Instinkt heraus: „Schau lieber Freund, in meinem Leben habe ich so einige heilige Menschen sterben sehen. Aber ich hab noch nie gesehen, wie ein Atheist stirbt. Drum bin ich dageblieben“. Es vergeht ein wenig Zeit im Schweigen. Dann macht er die Augen auf und sagt: „Setz dich her da! Wir reden.“ Ich bin zwei Stunden bei ihm geblieben. Es war die Zeit, in der er gebeichtet hat. Am Morgen darauf ist er gestorben.
Klopfet an, und es wird euch geöffnet werden!
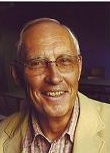 Dr. Maurice Caillet, der aus einer Familie stammte, in der der katholische Glaube völlig abgelehnt wurde, war jahrelang Mitglied einer Loge. Am 11. Februar 1984 machte er in Lourdes eine Erfahrung, die sein Leben total verändert hat.
Dr. Maurice Caillet, der aus einer Familie stammte, in der der katholische Glaube völlig abgelehnt wurde, war jahrelang Mitglied einer Loge. Am 11. Februar 1984 machte er in Lourdes eine Erfahrung, die sein Leben total verändert hat.
Dr. Maurice war Gynäkologe im Krankenhaus von Renner. Eines Tages erkrankte seine Frau und wurde vollständig gelähmt. In der Hoffnung auf Hilfe reiste er nach mehr als einem Jahr mit seiner schwerkranken Frau in einen Warmwasser-Kurort in den Pyrenäen.
Diese Kur hatte keine Besserung gebracht. Auf dem Rückweg kamen sie in die Gegend von Lourdes. Obwohl er nicht an Gott glaubte, brachte er seine Frau nach Lourdes. Er klammerte sich an die Hoffnung, dass ein Bad im Lourdeswasser, von dem er einmal gehört hatte, ihr vielleicht helfen könnte. Während seine Frau auf das Bad wartete, stand er draußen im kalten Wind. Er schaute um sich, ob er irgendwo hineingehen könnte und erblickte eine Tür. Als er eingetreten war, sah er, dass es eine Kapelle war und ein Priester gerade die hl. Messe feierte. Wegen der Kälte blieb er dort. Als das Evangelium vorgelesen wurde, hörte er die Worte Jesu (Mt 7,7): „Klopft an, dann wird euch geöffnet!“ Diese Worte des Herrn waren dieselben, die er aussprechen musste, um einen höheren Rang in der Freimaurer-Loge zu erlangen. Es erschreckte ihn, dass dafür ein Evangeliumstext benutzt wurde. Gleichzeitig hörte er in seinem Inneren eine Stimme: „Du hoffst, dass deine Frau hier geheilt wird, aber was tust du selbst?“ Von diesem Wort war er so tief betroffen, dass er gleich nach der hl. Messe zum Priester ging und sagte: „Ich will sofort getauft werden.“ Dieser erklärte, er müsse sich einige Monate darauf vorbereiten.
Seine Frau war nach dem Bad noch genauso krank wie vorher, aber er selbst war von seinem Unglauben geheilt. Als Dr. Maurice wieder in Renner war, kündigte er seine Stelle im Krankenhaus, weil er keine Abtreibungen mehr vornehmen wollte, denn als Freimaurer hatte er besonders aktiv an der Abtreibungsgesetzgebung mitgearbeitet.
Am Tag seiner Taufe geschah dann ein Wunder: Seine Frau wurde völlig geheilt.
Von da an begann er, überall in Vorträgen Zeugnis zu geben von der Gnade, die Gott ihm geschenkt hatte. Er wies auch immer wieder darauf hin, dass viele hohe Politiker und Beamte auch einen hohen Rang in der Freimaurerei einnehmen und dass die Freimaurerei verantwortlich sei für die liberalen Gesetzgebungen von Ehescheidung, Abtreibung, Homo-Ehe, Trennung von Kirche und Staat, antikirchlichen Schulprogrammen usw. Als er bei den Freimaurern austrat, wurde er mit dem Tod bedroht. Er beschloss daraufhin, überall in Frankreich Vorträge über die große Gefahr der Mitgliedschaft bei den Freimaurern zu halten und setzte sich auch mit aller Kraft für den Schutz der ungeborenen Kinder ein.
Immer wieder bezeugte er bis heute (82-jährig): es sei ihm unbegreiflich, dass der Heiland ihn nach einem Leben des Hasses gegen die Kirche und nach all seinen Missetaten zur großen Gnade des Glaubens gerufen hat.
Schutz im Unbefleckten Herzen Mariens
 In seinem neuesten Buch: „L’ultimo esorcista – La mia battaglia contro Satana“ (bis jetzt nur italienisch) beschreibt der in Rom lebende Exorzist Gabriele Amorth seine Erfahrungen im Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Er sagt unter anderem:
In seinem neuesten Buch: „L’ultimo esorcista – La mia battaglia contro Satana“ (bis jetzt nur italienisch) beschreibt der in Rom lebende Exorzist Gabriele Amorth seine Erfahrungen im Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Er sagt unter anderem:
„Der Angriff des Satans gilt hauptsächlich denen in der Welt, die Machtpositionen einnehmen. Denn wenn er Menschen in sein Netz zieht, die große Verantwortung tragen, bedeutet dies, dass er so wie beim Fall von Dominosteinen viele andere zu den seinen macht. Und dann: Die am meisten Angegriffenen sind die Männer der Kirche. Warum? Weil sie die Heiligen Gottes sein sollten, und wenn sie sich dagegen von Satan überwältigen lassen, werden sie im Gegenteil zu Gottes Feinden.
Satan greift vor allem den Papst an. Sein Hass auf den Nachfolger Petri ist extrem heftig. Diese Erfahrung habe ich bei meinen Exorzismen gemacht. Wenn ich Johannes Paul II. nenne, schäumen die Dämonen vor Wut. Andere schreien und flehen darum, ihn nicht mehr zu nennen. So auch bei Benedikt XVI. Jede Geste des Papstes, seine so innigen und ruhigen Liturgiefeiern, sind ein mächtiger Exorzismus gegen das Wüten des Teufels.
Nach dem Papst greift der Satan die Kardinäle, die Bischöfe und alle Priester und Ordensleute an. Das ist normal. Keiner darf sich darüber entrüsten. Und ebenso wenig darf man sich entrüsten, wenn einige in der Kirche den Schmeicheleien nachgeben und sich überwältigen lassen. Die Priester, die Ordensmänner und Ordensfrauen sind zu einem harten geistlichen Kampf aufgerufen. Nie dürfen sie dem Teufel nachgeben. Wenn sie die Tür ihrer Seele auch nur ein wenig dem Teufel öffnen, tritt dieser ein und nimmt sich ihr ganzes Leben“ (vgl.: kath.net).
Wie können wir uns schützen? Die Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens ist für uns ein ganz mächtiger Schutz. Maria wird über uns ihren Schutzmantel ausbreiten, wenn wir sie inständig bitten und uns selbst und alle Menschen, die unserem Gebet anvertraut sind, immer wieder ihr übergeben.
„Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen.“
Maria ist unsere Mama!
 Padre Pierino Galeone, der über 20 Jahre an der Seite von P. Pio lebte, beschrieb in den Zeugenaussagen für den Heiligsprechungsprozess von Padre Pio das für ihn prägendste Erlebnis, durch das ihm die Liebe zu Maria im Herzen entzündet wurde.
Padre Pierino Galeone, der über 20 Jahre an der Seite von P. Pio lebte, beschrieb in den Zeugenaussagen für den Heiligsprechungsprozess von Padre Pio das für ihn prägendste Erlebnis, durch das ihm die Liebe zu Maria im Herzen entzündet wurde.
Am 14. August 1958, dem Vorabend zu Maria Himmelfahrt, lud ihn P. Carmelo, der Guardian des Klosters, ein, mit ihm zur Zelle von P. Pio zu gehen und ihn um einen kleinen Gedanken über die Muttergottes zu bitten. P. Pio saß in seiner Zelle in einem Sessel, den Rosenkranz in der Hand. Der Pater Guardian bat ihn im Hinblick auf das Muttergottesfest: „Geistlicher Vater, sagen Sie uns bitte einen Gedanken dazu.“ P. Pio neigte den Kopf, begann zu schluchzen und versuchte mehrmals zu sagen: „Die Gottesmutter … die Muttergottes …“ und zum dritten Mal wiederholte er: „Die Gottesmutter ist unsere Mama! “ Heftiges Weinen erschütterte ihn. Mit Mühe zog er ein Taschentuch hervor, um sich das tränenüberströmte Gesicht zu trocknen. Die Tränen flossen unaufhörlich, und weinend rief er: „Die Muttergottes ist unsere Mama, die Madonna ist unsere Mama!“ Langsam hörte P. Pio auf zu weinen und erteilte den beiden den Segen. Während sie die Zelle verließen, fühlten sie, wie ihre Herzen vor Liebe zur Muttergottes brannten. Einer sagte zum anderen: „Ich schaffe es nicht, das Feuer der Liebe zur Muttergottes zu fassen, das mir der Padre ins Herz gelegt hat. Wir haben um ein Wort gebeten, und er hat uns ein Feuer der Liebe geschenkt.“
