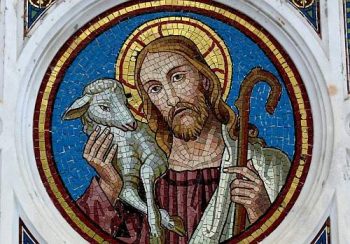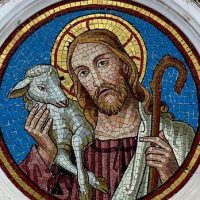Der Polarforscher und Expeditionsleiter Sir Ernest Shackleton wurde durch seine Antarktis-Expedition (1914-1917) weltberühmt. Nicht etwa, weil er den Südpol erreichte, sondern weil er nach dem Untergang des Expeditionsschiffes im Packeis und nach einer abenteuerlichen Odyssee im Eismeer seine gesamte Mannschaft (27 Männer) lebend zurückbrachte.
Im Dez. 1914 brach Shackleton mit seinem Schiff von der Walfängerstation auf der Insel Südgeorgien nach Süden auf. Als er sah, dass sie hoffnungslos im Eis gefangen waren und das Schiff unterging, hatte er nur mehr ein Ziel, nämlich alles zu tun, um seine Mannschaft wieder heil nach Haus zu bringen. Er führte seine Leute mit viel Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen, Moral und strahlte im Vertrauen auf die Vorsehung einen Optimismus aus, mit dem er in jedem Rückschlag eine neue Chance sah. Er hat von seinen Leuten viel verlangt, aber war auch selber bereit, mit großer Selbstlosigkeit, alles zu geben. Als z.B. einer aus der Crew bei einer Bootsfahrt seine Handschuhe verlor, gab ihm Shackleton die seinen und hatte als Konsequenz unter Erfrierungen seiner Finger zu leiden.
Sie haben fast zwei Jahre festgesessen in dieser unwirtlichen Welt. Mit den Rettungsbooten konnten sie Elephant Island erreichen. Shackleton beschloss dann, mit fünf Männern in einem der Rettungsboote die über tausend Kilometer entfernte Walfangstation auf der Insel Südgeorgien zu erreichen, von der sie aufgebrochen waren. 15 Tage lang waren sie unterwegs auf einer Nussschale in einem riesigen Ozean. Völlig erschöpft kamen die sechs Männer in Südgeorgien an, aber auf der falschen Seite. Die Station war auf der anderen Seite der Insel, die mit hohen verschneiten Bergketten durchzogen war.
Shackleton machte sich mit zwei Gefährten auf den Weg über die Berge. Es war ein Gewaltmarsch von 36 Stunden mit nur kurzen Pausen. Bei einer dieser Pausen waren seine Gefährten vor völliger Erschöpfung sofort eingeschlafen. Shackleton wusste natürlich, wenn sie ein paar Minuten zu lange schlafen, werden sie an Erfrierung sterben. Er hat sie nach 5 Minuten geweckt. Und als sie ihn fragten, wie lange sie geschlafen haben, sagte er, eine halbe Stunde, um ihnen den Mut zu vermitteln, dass sie ausgeruht sind und genug Kraft haben, um die Berge zu überwinden. Und sie hatten es geschafft, die Station erreicht. Nach vielen vergeblichen Versuchen gelang es Shackleton auch, die gesamte zurückgelassene Mannschaft auf Elephant Island zu retten.
Es war wie ein Wunder, denn viele andere Expeditionen, die in dieser Zeit unternommen wurden, verzeichneten eine Reihe von Todesopfern.
Es wurde später viel über den weisen und klugen Führungsstil von Shackleton geschrieben. Kennzeichnend war für ihn vor allem die Selbstlosigkeit, mit der er sich immer um das Wohl seiner Gefährten sorgte. Er war kein besonders religiöser Mann, aber er war sich dessen bewusst, dass Gottes Vorsehung ihn auch in allen Rückschlägen begleitet. In sein Tagebuch schrieb er:
„Wenn ich auf diese Tage zurückblicke, habe ich keinen Zweifel daran, dass die Vorsehung uns nicht nur über diese Schneefelder, sondern auch über das sturmweiße Meer führte, das Elephant Island von unserem Landeplatz auf Südgeorgien trennte. Ich weiß, dass es mir während dieses langen und quälenden Marsches von sechsunddreißig Stunden über die namenlosen Berge und Gletscher Südgeorgiens oft vorkam, als wären wir vier und nicht drei. Ich habe meinen Kameraden gegenüber nichts dazu gesagt, aber später sagte Worsley zu mir: ‚Boss, ich hatte auf dem Marsch das seltsame Gefühl, dass noch eine weitere Person bei uns war.‘ Crean gestand, dass er denselben Gedanken hatte.“
Gott ist bei denen, die sich selbstlos hingeben zum Heil und zur Rettung der andern.
 Jesus ruft uns in der Bergpredigt auf: „Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist!“ (Lk,6,36f).
Jesus ruft uns in der Bergpredigt auf: „Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist!“ (Lk,6,36f).