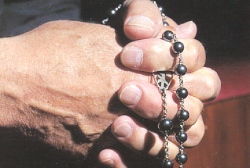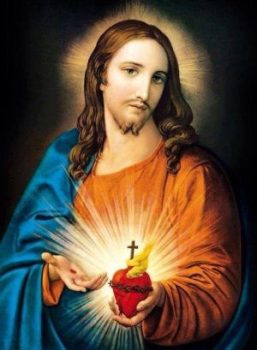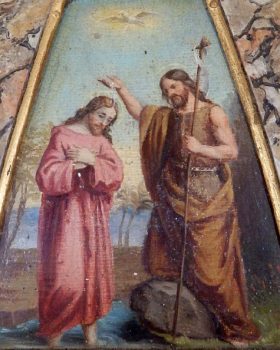Seit 2021 wirken die „Mutter-Teresa-Schwestern“ im Libanon, im nördlichen Teil des Landes, im Bergland, das an die tiefe Schlucht grenzt, die das „heilige Tal“ genannt wird. Dort sind einige der frühesten christlichen Klöster der Welt entstanden. Bis heute leben Christen, auch Eremiten, im Tal bzw. in der näheren Umgebung. Die Mutter-Teresa-Schwestern haben ein kleines Kloster in der Gegend und nehmen sich der Armen an. In der Zeitschrift ‚Maria, das Zeichen der Zeit‘ (Nr. 212) berichtet eine der Schwestern über ihre Arbeit.
Seit 2021 wirken die „Mutter-Teresa-Schwestern“ im Libanon, im nördlichen Teil des Landes, im Bergland, das an die tiefe Schlucht grenzt, die das „heilige Tal“ genannt wird. Dort sind einige der frühesten christlichen Klöster der Welt entstanden. Bis heute leben Christen, auch Eremiten, im Tal bzw. in der näheren Umgebung. Die Mutter-Teresa-Schwestern haben ein kleines Kloster in der Gegend und nehmen sich der Armen an. In der Zeitschrift ‚Maria, das Zeichen der Zeit‘ (Nr. 212) berichtet eine der Schwestern über ihre Arbeit.
Das Dorf, in dem sie wirken, wurde im September 2024 von einigen Unglücksfällen heimgesucht. Eine fünfköpfige Familie kam bei einem Autounfall ums Leben. Ein Mann, der einem anderen nach dem Einsturz einer Mauer zu Hilfe eilte, kam selber ums Leben, da ein weiteres Mauerstück auf ihn fiel. Erschüttert von dem Geschehen, beschlossen die Dorfbewohner, mehrere Tage lang Anbetung sowie eine Novene zur Gottesmutter und zur hl. Mutter Teresa zu halten. In einer Prozession mit dem Allerheiligsten gingen sie betend an alle Unfallorte. Man gedachte der Toten und flehte zu Gott um Bewahrung vor weiterem Unglück.
Wenige Tage später war ein 20-jähriges Mädchen, dessen Mutter im Kloster der Mutter-Teresa-Schwestern mithilft, auf dem Rückweg ins Dorf. Sie wurde unterwegs von einem Auto mitgenommen. Kurz vor dem Ziel, als das Auto auf der kurvenreichen Straße talwärts fuhr, verlor der Fahrer plötzlich die Kontrolle über den Wagen. Ungebremst schoss das Auto talwärts. Auf der Straße kam ihnen eine Frau mit einem kleinen Kind entgegen, auf der anderen Seite stand ein Haus an einem steilen Abhang. Eine Katastrophe schien unausweichlich, egal, auf welche Seite der Wagen steuern würde. Die junge Frau im Auto, tief gläubig, rief laut zur heiligen Jungfrau um Hilfe und griff instinktiv nach der großen Wunderbaren Medaille, die sie stets um den Hals trug.
Plötzlich blieb das Auto mit einem großen Ruck stehen. Ein Rad war auf wundersame Weise in einer Rinne am Straßenrand stecken geblieben, noch bevor das Auto das Haus oder die Frau mit dem Kleinkind erreicht hatte. Das junge Mädchen hatte einen Schock, blieb eine Weile zitternd im Auto sitzen und merkte sodann, dass ihre Wunderbare Medaille nicht in ihrer immer noch zusammengekrampften Hand war. Sie durchsuchte das Auto, fand sie aber nicht. Später, als sie nach Hause kam, merkte sie, dass sie an jenem Tag die Medaille nach dem Duschen im Bad vergessen hatte. Der Himmel und die Gottesmutter hatten nicht auf dieses Versäumnis geschaut, sondern auf die Liebe, das Vertrauen und Beten dieses Mädchens und der Dorfgemeinschaft. Alle Dorfbewohner sind sich einig: Das Rosenkranzgebet, das dieses Mädchen treu pflegt, sowie das Gebet, die Novene und eucharistische Prozession der Bevölkerung haben zu dieser Bewahrung geführt.