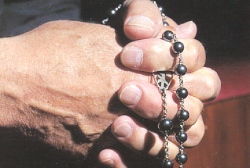Am Pfingstfest feiern wir die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die junge Kirche. Der Herr hat den verheißenen Tröster und Beistand gesandt.
Am Pfingstfest feiern wir die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die junge Kirche. Der Herr hat den verheißenen Tröster und Beistand gesandt.
Wir haben diesen Heiligen Geist bei unserer Taufe und Firmung empfangen. Er will mit jedem von uns Großes wirken zu unserem Heil und zum Heil unserer Mitmenschen. Nur geht es für uns darum, dass wir uns vom Heiligen Geist auch wirklich leiten lassen.
Unser Leben bringt viele Entscheidungen mit sich. Die Erfüllung unserer täglichen Aufgaben erfordert viel Einsicht und Unterscheidung. Es ist oft schwierig, inmitten der Forderungen, die unsere Gesellschaft stellt, den christlichen Weg klar zu erkennen.
Wovon lassen wir uns also leiten? Ist es der Geist der Welt? Schließen wir uns dem an, was heute modern ist, was die meisten tun und denken? Oder hören wir auf den Heiligen Geist? Aber wie können wir seine Führung konkret erfahren?
1) Der Heilige Geist wirkt durch innere Eingebung. Wir empfangen von ihm Einsichten und gute Gedanken, die uns näher zu Gott, zur Wahrheit und zum Tun des Guten hinführen. Jesus sagt: „Der Hl. Geist wird uns in die ganze Wahrheit führen.“ Es ist vor allem die Wahrheit über uns selbst und den Willen Gottes. Für diese Wahrheit haben wir einen inneren Spürsinn, das ist unser Gewissen. Und wenn wir suchen, dem Gewissen zu folgen, das befiehlt, das Böse zu meiden und das Gute zu tun, dann sind wir schon auf dem Weg des Heiligen Geistes.
Aber wir müssen damit rechnen, dass wir uns bei diesen inneren Eingebungen sehr leicht täuschen können, besonders im Gebet, im Leiden und im Handeln. Genau diese Bereiche sind der Lieblingsaufenthalt unserer Selbsttäuschungen. Hier kann es leicht passieren, dass wir unseren „eigenen Vogel“ für den Heiligen Geist halten.
2) Darum muss zur inneren Führung noch die äußere hinzukommen, die uns durch die Kirche geschenkt wird. Jesus sagt: „Der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ Das tut er vor allem durch die Kirche. Immer wieder hören wir das Wort Gottes, die Lehre des Glaubens und wir werden erinnert an die Gebote Gottes. Wer sich an das Evangelium und die Lehre der Kirche hält, der ist sicher unter der Führung des Heiligen Geistes.
Er erleuchtet uns auch durch die Sakramente, vor allem durch das Bußsakrament. Denn durch die Vergebung der Sünden wird immer wieder die Finsternis vertrieben, die durch unsere Fehler, Sünden und Schwächen in unser Herz gekommen ist.
3) Der Geist Gottes führt uns schließlich durch die verschiedenen Umstände der Vorsehung, durch gute Menschen, die uns einen Rat geben, uns helfen und beistehen.
Die entscheidende Voraussetzung aber für das Wirken des Hl. Geistes ist die Demut des Herzens, ist das hörende Herz. Nur den Demütigen schenkt Gott seine Gnade.