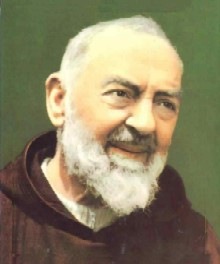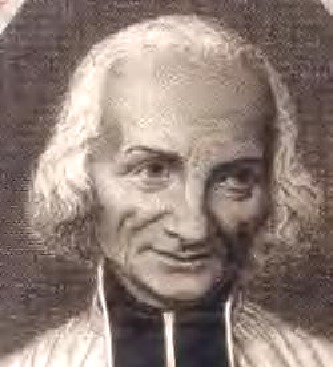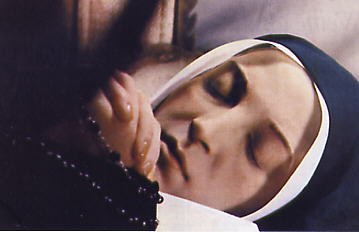Der schon verstorbene Pfarrer B. Reuter aus Deutschland, der die Notzeit nach dem ersten Weltkrieg erlebt hatte, erzählte immer mit großer Ergriffenheit, wie ihm der hl. Josef einmal geholfen hatte. Das könnte auch für uns ein Ansporn sein, im Monat März, der dem hl. Josef geweiht ist, ihn um seine Fürsprache zu bitten, da vielleicht ähnliche Notzeiten wieder auf uns zukommen könnten.
Der schon verstorbene Pfarrer B. Reuter aus Deutschland, der die Notzeit nach dem ersten Weltkrieg erlebt hatte, erzählte immer mit großer Ergriffenheit, wie ihm der hl. Josef einmal geholfen hatte. Das könnte auch für uns ein Ansporn sein, im Monat März, der dem hl. Josef geweiht ist, ihn um seine Fürsprache zu bitten, da vielleicht ähnliche Notzeiten wieder auf uns zukommen könnten.
Er war damals im Priesterseminar. Seine Eltern konnten ihn kaum finanziell unterstützen, da sie selber nicht viel besaßen. Damit er sich die fürs Studium nötigen Bücher und Unterlagen kaufen konnte, machte er einmal sogar Schulden. Er unterschrieb einen Wechsel von 260.-DM, damals für einen Studenten viel Geld, und dachte, dass er das Geld schon irgendwie bekommen werde. Der Tag der Einlösung des Wechsels kam immer näher, aber er hatte das Geld noch immer nicht beisammen. So begann er eine Novene zum hl. Josef. Er bat ihn inständig um seine Hilfe, aber es kam kein Lichtblick.
Schon war der Tag der Einlösung angebrochen. In der Früh bei der hl. Messe betete er noch einmal zum hl. Josef. Er war schon fast verzweifelt und in Versuchung dem hl. Josef zu grollen. Mit dieser niedergeschlagenen Stimmung kam er aus der hl. Messe. Da ging der Regens des Seminars auf ihn zu und teilte ihm mit, dass für ihn Geld abgegeben worden sei. Ein alter Mann mit einem Bart habe es ihm übergeben. Er wollte gerne wissen, wer das war, aber der Regens wusste es nicht und auch an der Pforte, an der er hätte vorbeikommen müssen, hatte niemand diesen Mann mit Bart gesehen. Da wurde ihm klar, das kann nur der hl. Josef selber gewesen sein. Es war genau die Summe, die für den Wechsel fällig war.
Später erzählte er dem Regens diese Begebenheit. Da leuchtete das Gesicht des Regens auf und er sagte: „Dann habe ich ja dem hl. Josef die Hand gegeben.“