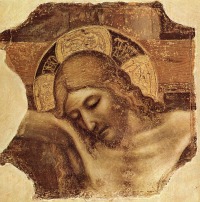Ein Vater betrat mit seinem kleinen Sohn ein Geschäft, in dem er einige Kleinigkeiten besorgen wollte. Nachdem der Vater die Waren bezahlt hatte, forderte der freundliche Verkäufer den Jungen auf, eine Handvoll Bonbons aus dem Glas zu nehmen. Der Junge aber hielt sich zurück. „Was ist los?“, fragte der Mann. „Magst du keine Bonbons?“ Das Kind nickte eifrig. Und lächelnd steckte der Verkäufer selber seine Hand in das Bonbonglas und stopfte dem kleinen Jungen eine große Portion in die Taschen. Später fragte der Vater seinen Sohn, warum er nicht gleich zugegriffen habe, als er dazu aufgefordert wurde. „Weil seine Hand größer ist als meine“, erwiderte der Junge. Gottes Hände sind groß und großzügig. Seine Hand ist so viel größer als unsere. Er tut mehr für uns, als wir uns vorstellen können – wenn wir es ihm überlassen! Die wahre Weisheit besteht darin, darauf warten zu können, bis er uns beschenkt.
Ein Vater betrat mit seinem kleinen Sohn ein Geschäft, in dem er einige Kleinigkeiten besorgen wollte. Nachdem der Vater die Waren bezahlt hatte, forderte der freundliche Verkäufer den Jungen auf, eine Handvoll Bonbons aus dem Glas zu nehmen. Der Junge aber hielt sich zurück. „Was ist los?“, fragte der Mann. „Magst du keine Bonbons?“ Das Kind nickte eifrig. Und lächelnd steckte der Verkäufer selber seine Hand in das Bonbonglas und stopfte dem kleinen Jungen eine große Portion in die Taschen. Später fragte der Vater seinen Sohn, warum er nicht gleich zugegriffen habe, als er dazu aufgefordert wurde. „Weil seine Hand größer ist als meine“, erwiderte der Junge. Gottes Hände sind groß und großzügig. Seine Hand ist so viel größer als unsere. Er tut mehr für uns, als wir uns vorstellen können – wenn wir es ihm überlassen! Die wahre Weisheit besteht darin, darauf warten zu können, bis er uns beschenkt.